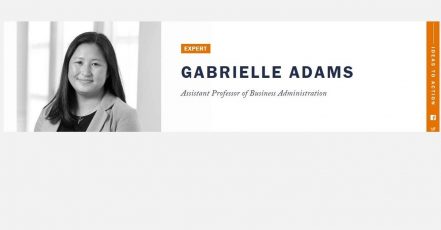Eines der wohl prägnantesten Beispiele für die Kunst der Reduktion ist Google. Als die weltweit am meisten genutzte Suchmaschine vor vielen Jahren in Erscheinung trat, war da nur das prägnante Logo und ein (einziges) Suchfeld auf dem Bildschirm, sonst nichts. Platzhirsch Yahoo hingegen bot auf dem Screen eine ganze Welt voller Themen. Doch die scheinbare Einfachheit von Google lief der Konkurrenz den Rang ab, bis heute.
Auch Gabrielle Adams, Assistant Professor an der Darden School of Business, University of Virginia, hat sich in einer Studie mit der Kunst des Weglassens bzw. Wegnehmens (Reduzierens) beschäftigt. Sie hat feststellt, dass Menschen sich viel öfters bei der Lösung eines Problems darauf konzentrieren, was hinzugefügt werden könnte, als darauf, etwas wegzunehmen. Doch ein bewusstes Weglassen oder Subtrahieren könnte vieles zum Positiven verändern, nicht nur im Business, sondern auch im Alltag. Denn viele Menschen kämpfen mit einem "Zuviel" an allem: zu viele Informationen, ein überfüllter Terminkalender, ein vollgestopftes Zuhause.
Um ihre Annahmen zu stützen, führte Gabrielle Adams zusammen mit den Kolleg*innen Benjamin Converse und Leidy Klotz sowie dem Professor Andrew Hales von der University of Mississippi eine Reihe von Experimenten durch. Die Forscher fanden heraus, dass es den Teilnehmern tatsächlich nicht von alleine gelang, einfachere, "subtraktive" Lösungen zu finden. In einem Lego-Bauwettbewerb sollten die Teilnehmer eine instabile Plattform stabilisieren. 59 Prozent von ihnen "kauften" und fügten zusätzliche Steine hinzu, anstatt einen einzelnen Stein wegzunehmen, der die Plattform ebenfalls stabilisiert hätte – dies wäre die "kostenlose" Lösung im Experiment gewesen.
Obwohl die subtraktive Lösung (das Wegnehmen eines einzelnen Lego-Steins) sowohl effizienter als auch profitabler war, bemerkten die Teilnehmer dies nur, wenn das Experiment eine Erinnerung bot (Hinweis: "Das Entfernen von Steinen ist frei und kostet nichts"). Doch auch in diesen Fällen entschieden sich immerhin noch 39 Prozent der Teilnehmer*innen für das Hinzufügen von Lego-Steinen.
Das Forschungsteam untersuchte die Vernachlässigung der Subtraktion in anderen Experimenten: mit Aufsätzen, Rezepten, Reiseplänen und Minigolf. "In fast allen Fällen", so Adams, "waren die Menschen eher bereit zu addieren." Die einzigen Ausnahmen betrafen ungewöhnliche Zusätze, wie "gegrillter Käse mit einem Stück Schokolade". Die meisten Teilnehmer kamen dabei zu dem Schluss, dass das Entfernen die beste Wahl war.
Der Wert des Weglassens für den Markterfolg
In einer Welt, in der Produkte in der Regel mit den Vorteilen des Addierens beworben werden (z.B. "30 Prozent mehr" oder "Neue Features"), kann die SUBTRAKTION ein starker, aber häufig unterschätzter Wettbewerbsvorteil sein.
Für die positive, verkaufsfördernde Wirkung von REDUKTION gibt es bereits einige Beispiele. So hat vor allem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Subtraktion in den letzten Jahren erfolgreich eingesetzt: Kleinere Portionsgrößen wie z.B. "100-Kalorien-Snackbeutel" oder "Mini-Limonaden" erfüllen den Bedarf der Verbraucher*innen nach weniger Kalorien. Das Strider Balance-Fahrrad des Erfinders Ryan McFarland ist ein weiteres Beispiel für "Gewinn durch Subtraktion": Indem er die Pedale entfernte, schuf McFarland eine neue, bessere Möglichkeit für Kinder, das Radfahren zu lernen.
Im Produktmarketing könnte es künftig immer wichtiger werden, über "Weniger" statt "Mehr" zu reden und die Subtraktion ins Gespräch zu bringen. Adams und ihre Co-Autoren stellen fest, dass die Tendenz vieler Menschen, lieber etwas "hinzuzufügen" statt etwas "wegzunehmen" oder "wegzulassen" ein Grund für Überlastung, Bürokratie sowie eine dauerhafte Schädigung des Planeten sein könnte.
Wie kann man also den persönlichen, betrieblichen und auch gesellschaftlich-politischen "Standardmodus der Addition" überwinden und stattdessen stärker die Subtraktion fördern? Gabrielle Adams hat drei einfache Tipps:
Tipp 1: Regelmäßiges Reflektieren: Was ist überflüssig? Können zwei einzelne Dinge miteinander kombiniert werden? Was würde es mich/uns kosten, etwas wegzulassen? Wie kann das Produkt, der Prozess, das Verfahren etc. einfacher gestaltet werden?
Tipp 2: Ablenkungen reduzieren: Wenn man unter Stress steht oder mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt ist, neigt man dazu, bei Problemen oder neuen Herausforderungen auf vertraute Gewohnheitsmuster zurückzugreifen. Die "Standardeinstellung" besteht darin, Dinge hinzuzufügen und Subtraktionen zu ignorieren. Ironischerweise kann dies dazu führen, dass wir uns noch mehr aufbürden und noch mehr unter Stress geraten, statt die optimale Lösung durch Vereinfachung zu finden.
Tipp 3: Das "Weniger" sichtbar zelebrieren. Unternehmen, die den Energieverbrauch, die Material- und Ressourcen-Verschwendung, die Komplexität, die Bürokratie etc. reduzieren, sollten dies selbstbewusst vermarkten – sowohl bei den Entscheidungsträgern im Unternehmen als auch in der Öffentlichkeit.
Zu dem Thema ist ein Fachartikel mit dem Titel "People Systematically Overlook Subtractive Changes" erschienen. Dieser wurde von Prof. Gabrielle Adams zusammen mit Benjamin A. Converse von der Frank Batten School of Leadership & Public Policy und der Graduate School of Arts & Sciences der UVA, Andrew H. Hales vom Department of Psychology der University of Mississippi und Leidy E. Klotz von der School of Engineering and Applied Science und der School of Architecture der UVA verfasst.
Titelbild: Gabrielle Adams, Assistant Professor an der Darden School of Business (Quelle: https://ideas.darden.virginia.edu/gabe-adams)
Verwandte Themen:
Marketingstrategie, Produktmarketing, Verbraucherverhalten, Konsumverhalten, Verhaltenspsychologie, Problemlösung, Reduktion, Weglassen, CSR, Information Overload, Überfrachtung, Studie, Gabrielle Adams, Darden School of Business
Keinen Marketing-Trend mehr verpassen? marketingScout Newsletter